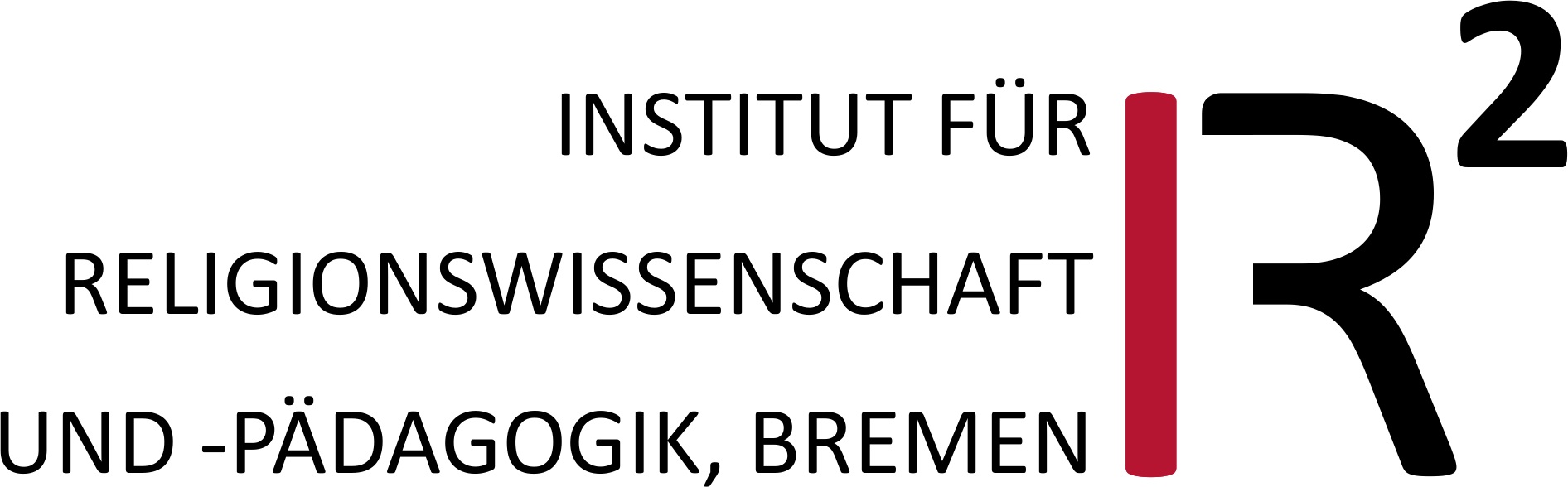VIRR - Veröffentlichungen des Instituts für Religionswissenschaft und Religionspädagogik
sowie Veröffentlichungen der "Religionswissenschaftlichen Fachdidaktik"

In dieser Schriftenreihe publizieren wir die Ergebnisse besonders herausragender Abschlussarbeiten, Veranstaltungsreihen, Berichte zu Forschungsprojekten und weitere gemischte Beiträge von Mitgliedern des Instituts. Die Publikationen sind online frei verfügbar; verschiedene Bände können auch in gedruckter Form über die Universitätsbuchhandlung erworben werden.
Print: ISSN 2199-7535
Online: ISSN 2199-5397
VIRR / Religionswissenschaftliche Fachdidaktik
- Band 16: H. Jacob: Der Tod ist ein großes Geheimnis. Hintergründe und Impulse für den Unterricht zu dem Bilderbuch Abschied von Opa Elefant
- Band 15: K. Storm: Religionssensibilität in der Sozialen Arbeit
- Band 14: S. Ghozzi-Ben Miled: „Tim und Struppi“ – Westliche Konstruktionen des Nahen Ostens in popkulturellen Medien.
- Band 13: H. Jacob: Die Moschee in der Schule. Kompetenzförderung durch Entdeckendes Lernen – eine Moscheeerkundung in der Grundschule
- Band 12: G. Klinkhammer et al.: Islamfeindlichkeit in christlichen Medien. Eine qualitative Studie zu antimuslimischem Rassismus in ausgewählten christlichen Online-Medien
- Band 11: J. Chilinski: Der Terroranschlag in Halle und die diskursive Aushandlung der Rassifizierung von Religion
- Band 10: L. Lambert: Säkulares Luxemburg? Entstehung und Auswirkungen eines Säkularisierungsprozesses
- Band 9: J. Jüling: Figurationen des Orients
- Band 8: T. Hannemann (Hrsg): Studien zur Reformation in Bremen
- Band 7: G. Klinkhammer & E. Tolksdorf (Hrsg): Somatisierung des Religiösen
- Band 6: G. Klinkhammer & T. Spieß: Dialog als dritter Ort
- Band 5: A. Drewitz: Virtuelle Diskursgemeinschaften
- Band 4: M Döbler et.al.: Religionspädagogik zwischen religionswissenschaftlichen Ansprüchen und persönlichen Erwartungen
- Band 3: G. Klinkhammer & H. de Wall: Staatsvertrag mit Muslimen in Hamburg: Die rechts- und religionswissenschaftlichen Gutachten
- Band 2: T.H. Peters: Islamismus bei Jugendlichen in empirischen Studien
- Band 1: G. Klinkhammer et.al.: Interreligiöse und interkulturelle Dialoge mit MuslimInnen in Deutschland
Zu den Bänden:
Band 16
Jacob, Hanna (2025): Der Tod ist ein großes Geheimnis. Hintergründe und Impulse für den Unterricht zu dem Bilderbuch Abschied von Opa Elefant
Bremen 2025, 74 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/3716
„Der Tod ist ein großes Geheimnis“, sagte der Elefantengroßvater.
Spazierengehen auf Wolken, Musizieren mit Engeln, Kartenspielen in der Hölle, Weiterleben als Schmetterling, Wiedergeburt als Elefant oder vielleicht doch nur die körperliche Vergänglichkeit – Vorstellungen von Schüler:innen zu der Frage, was denn eigentlich nach dem Tod kommt, sind vielfältig. Sie lassen sich als Postmortalitätsvorstellungen beschreiben, die sich aus Vorstellungen verschiedener religiöser und kultureller Einflüsse speisen und individuell entwickeln. Ebendiese Postmortalitätsvorstellungen, die sich in der europäischen Geschichte bis heute finden lassen, beschreiben Isabel Abedi (Text) und Miriam Cordes (Bild) in ihrem Bilderbuch Abschied von Opa Elefant.
Die vorliegende Veröffentlichung stellt die fachlichen und fachdidaktischen Hintergründe dar, etwa zu Postmortalitätsvorstellungen in der europäischen Geschichte und in der Entwicklung bei Kindern und Jugendlichen. Auf dieser Basis werden Vorschläge zur Erarbeitung des Bilderbuches Abschied von Opa Elefant im Unterricht gemacht und die dazugehörigen Materialien entwickelt.
Band 15
Storm, Katharina (2025): Religionssensibilität in der Sozialen Arbeit.
Zur Relevanz einer religionssensiblen Arbeit und den damit einhergehenden Bedarfen und Herausforderungen für pädagogische Fachkräfte.
Am Beispiel von der Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in der stationären Jugendhilfe in Bremen
Bremen 2024, 110 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/3637
Diese Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Bedarfe von Fachkräften in der sozialen Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF) in Bremen. Sie thematisiert die Bedeutung einer religionssensiblen Sozialen Arbeit, die darauf abzielt, die religiösen und kulturellen Hintergründe der Klient*innen zu respektieren und in die pädagogische Praxis zu integrieren. Anhand von Expert*inneninterviews wird untersucht, wie gut die Konzepte der Religionssensibilität in der Praxis umgesetzt werden und welche Kompetenzen Fachkräfte benötigen, um effektiv mit religiösen Themen und Praktiken umzugehen. Die Analyse zeigt, dass viele Fachkräfte täglich mit den religiösen Bedürfnissen ihrer Klient*innen konfrontiert sind, jedoch häufig nicht über das notwendige Wissen oder die Reflexionsfähigkeiten verfügen. Die Ergebnisse der Untersuchung verdeutlichen die Dringlichkeit einer fundierten Ausbildung in theologischen und religionswissenschaftlichen Inhalten sowie die Notwendigkeit regelmäßiger Fortbildungen. Zudem werden Impulse für eine verbesserte Teamarbeit und interdisziplinäre Kooperationen gegeben, um die Herausforderungen in der praktischen Arbeit zu meistern. Diese Arbeit liefert somit nicht nur eine fundierte Analyse der aktuellen Situation, sondern auch konkrete Empfehlungen zur Optimierung der Sozialen Arbeit mit umF, die für den Fachbereich von großer Relevanz sind.
Band 14
Ghozzi-Ben Miled, Samira (2024): „Tim und Struppi“ – Westliche Konstruktionen des Nahen Ostens in popkulturellen Medien. Eine Diskursanalyse zur
Konstruktion des Anderen
Bremen 2024, 69 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/3357
Die Abenteuer von Tim sind bis heutzutage Teil der popkulturellen Medienkultur von Kindern und Erwachsenen. Trotz des weltweiten Erfolges der Werke des belgischen Comiczeichners Hergé und seiner Figur Tim, wurde in den letzten Jahren auch die Kritik an einigen seiner Werke lauter. Unter anderem sah sich „Tim im Kongo“ (1930) vielmals mit Rassismusvorwürfen konfrontiert. Obwohl die Werke Hergés kritische Stimmen begleiten, sind sie weiterhin ein erfolgreicher Teil der Populärkultur und werden auch in andere Formate adaptiert. „Tim und Struppi“ – Westliche Konstruktionen des Nahen Ostens in popkulturellen Medien“ befasst sich mit der Episode von „Tim und Struppi im Reiche des schwarzen Goldes“. In dieser Forschung wird diese Episode als Comic (1972), Zeichentrickfilm (1991) und Videospiel (2001) verglichen und analysiert. Durch eine audio-visuelle Diskursanalyse nach Siegfried Jäger werden die drei Medien auf koloniale Konstruktionen, Stereotypisierungen und Exotisierungen des Nahen Ostens untersucht. Alle drei Medien entstehen zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Kontexten. Verändern die jeweiligen Diskurse und Machtverhältnisse, die um die Produktion des Mediums zirkulieren, die Darstellungen im Medium und das Spannungsfeld zwischen sagbarem und unsagbarem? Um diese Forschungsfrage zu beantworten werden bestimmte Aspekte, wie etwa die Darstellung „der“ islamischen Religion, innerhalb der drei Medien ausgewertet. Die Interpretation der Forschung gründet auf einen Großteil von Werken, die sich als postkoloniale Literatur einordnen lassen. Die Ergebnisse der Arbeit zeigen, dass beispielsweise Aspekte wie orientalistische Konstruktionen oder hegemoniale Machtstrukturen, in allen drei Medien kontinuierlich aufrechterhalten werden. Andererseits zeigen die Ergebnisse ebenfalls Diskontinuitäten, wie etwa einen Verzicht auf explizit religionskritische Inhalte im Zeichentrickfilm und Videospiel, die im Comic in verstärkter Form Raum erhalten. Eine weiterführende Forschung könnte sich mit der Perspektive von Rezipient:innen befassen. In diesem Zusammenhang kann beispielsweise erforscht werden, inwiefern die herausgearbeiteten Stereotypisierungen auf Rezipient:innen wirken.
Band 13
Jacob, Hanna (2024): Moschee in der Schule. Kompetenzförderung durch Entdeckendes Lernen – eine Moscheeerkundung in der Grundschule
Bremen 2024, 110 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/2785
Die Moschee für Schüler*innen?! Diese Monographie bietet Vorschläge für den kompetenzorientierten Unterricht mit Fokus auf eine Moscheeerkundung und reflektiert die Moschee als Lernort für Schüler:innen. Im Rahmen des Religionsunterrichts ist der Besuch von Sakralräumen besonders relevant. In den letzten Jahrzehnten wurden didaktische Ansätze für Sakralbauten vor allem für Kirchen erarbeitet. Die Erschließung von Sakralbauten außerhalb christlicher Traditionen ist hingegen unterrepräsentiert.
Durch die Verbindung von didaktischer Theorie mit religionsunterrichtlicher Anwendung und deren Beforschung im Kontext des Bremer Religionsunterrichts wird der grundlegenden Frage nachgegangen, inwiefern die Moschee als außerschulischer Lernort in den Unterricht integriert werden kann. Für die Konzeption einer entsprechenden Unterrichtseinheit, die den Besuch einer Moschee rahmt, werden kirchenraumpädagogische Überlegungen mit allgemeindidaktischer Forschung verknüpft. Dabei fließen Erkenntnisse zu den Zieltaxanomien nach Benjamin Bloom, den Choreographien des Unterrichts nach Fritz Oser sowie Überlegungen zu Betrachtungsweisen von Moscheen, die diese als multifunktionale Versammlungsorte verstehen, ein.
Anhand dieser vielschichtigen Perspektiven auf Moscheen wird nicht nur eine Unterrichtseinheit zum Entdeckenden Lernen dargelegt, sondern zudem Vorschläge für Moscheeerkundungen eröffnet und somit didaktisches Material zur kompetenzorientierten Gestaltung des überkonfessionellen Religionsunterrichts in der Grundschule angeboten.
Band 12
Klinkhammer, Gritt, Chillinski, Jacob, Lütge Rosa (2023): Islamfeindlichkeit in christlichen Medien. Eine qualitative Studie zu antimuslimischem Rassismus in ausgewählten christlichen Online-Medien
Bremen 2023, 86 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/2371
Für die vorliegende Studie wurden christliche Online-Medien in Bezug auf ihre Berichterstattung zu Islam und Muslim*innen, insbesondere aber deren Anknüpfung an islamfeindliche und rassistische Diskurse untersucht. Dazu wurden über 1000 Artikel evangelisch- und katholisch-konfessioneller Online-Medien, Zeitschriften und Gemeindeblätter aus dem Zeitraum 2015-2022 einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen. Auf dieser Grundlage konnten übergreifende Islambilder und wiederkehrende Muster einer perspektivisch-christlichen Berichterstattung identifiziert werden, mit denen in unterschiedlicher Intensität antimuslimischer Rassismus (re)produziert wird.
Die Untersuchung zeigt, dass über Islam und Muslim*innen vor allem in problemzentrierter Berichterstattung und mittels Techniken wie dem Othering gesprochen wird. Darüber hinaus werden spezifisch christliche Diskursformationen analysiert, die vor allem durch Themenkonjunkturen wie „Christenverfolgung“ oder einem „christzentrischen“ Blick auf Islam entstehen. Die Studie zeigt wie dieses selbstreferenzielle Sprechen über den Islam und Muslim*innen vielfach mit Selbstaufwertungen und kulturalisierenden Zuschreibungen einhergeht. Dadurch findet sich antimuslimischer Rassismus nicht nur im „rechten Christentum“ und verschwörungstheoretischen Deutungsmustern, sondern medien- und konfessionsübergreifend wieder.
Die Studie wurde vom Bundesministerium des Innern und für Heimat in Auftrag gegeben und diente dem Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit als externe Expertise für seinen Bericht „Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz“.
Band 11
Jacob Chilinski (2022): Der Terroranschlag in Halle und die diskursive Aushandlung der Rassifizierung von Religion. Eine Wissenssoziologische Diskursanalyse zu Antisemitismus und antimuslimischem Rassismus
Bremen 2022, 130 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/1796
Das Thema Rassismus ist zweifellos im öfentlichen Diskurs angekommen. Allerdings ist eine verstärkte Aufmerksamkeit für Rassismus nicht immer auch mit einer tefergehenden inhaltlichen Auseinandersetzung gleichzusetzen. Gerade in der öfentlichen Aushandlung der Rassifzierung von Religion sind einige Defzite und Konfiktlinien zu beobachten. In diesem Buch werden zentrale Wissensvorräte und Theorien zu Rassismus, Antsemitsmus sowie antmuslimischem Rassismus diskutert. Dabei wird gezeigt, dass die Fokussierung auf spezifsche Symbiosen von verschiedenen Rassifzierungen bisher marginal ist. Antworten auf die Frage, warum und wie dieses spezifsche Verständnis der Wirkweise des Systems Rassismus exkludiert wird, liefert eine Wissenssoziologische Diskursanalyse von drei Online-Medien. Mit einer Untersuchung der Berichterstatung zum Terroranschlag in Halle am 9. Oktober 2019 wird die öfentliche Diskussion von Antsemitsmus und antmuslimischem Rassismus beleuchtet. Dabei werden nicht nur blinde Flecken, Leerstellen und Herausforderungen im öfentlichen Diskurs über Rassismus entdeckt, sondern auch die positven Errungenschafen und diskursivierten Lösungsansätze besprochen. Durch diese Analyse wird sichtbar, dass die Zusammenschau verschiedener Rassismen ein detaillierteres Bild der Mechanismen von Rassifzierung ermöglicht.
Band 10
Lambert, Liz (2020): Säkulares Luxemburg? Entstehung und Auswirkungen eines Säkularisierungsprozesses
Bremen 2020, 103 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: https://doi.org/10.26092/elib/398
Im Großherzogtum Luxemburg stand im Laufe des letzten Jahrzehntes insbesondere ein Thema im Mittelpunkt vieler politischer und gesellschaftlicher Debatten: die Trennung von Staat und Religion.
Mit dem Argument, den Interessen und der Pluralität der luxemburgischen Gesellschaft gerecht zu
werden, wurde die Säkularisierung vor allem durch die 2013 gewählte Regierung Bettel-SchneiderI
erheblich vorangetrieben.
Liz Lambert analysiert einzelne Aspekte dieses Säkularisierungsprozesses, indem sie erstens einen historischen Abriss der diesbezüglichen Entwicklungen seit der Zeit Napoleons darlegt, zweitens eine Analyse der jüngeren Entwicklungen (Regierungswechsel von 2013 und Abkommen von 2015) anstellt und drittens darauf eingeht, wie sich dieser Prozess auf die religiösen Institutionen sowie die freigeistigen Vereine ausgewirkt hat
Band 9
Jaqueline Jüling (2018): Figurationen des Orients. Eine Analyse von August Tholucks Orientbild und seiner Beziehung zur deutschen Orientalistik im 19. Jahrhundert
Bremen 2018, 144 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00106972-15
In dieser Monographie wird der Beantwortung von drei Forschungsfragen nachgegangen, die sich mit dem Erweckungstheologen Friedrich August Gotttreu Tholuck befassen. Zunächst soll die Analyse von Tholucks Orientschriften darüber Auskunft geben, wie er seinen Orient charakterisiert und gestaltet hat sowie in welchem Verhältnis dieses Bild zu den zeitgenössischen Orientdiskursen steht. Im Anschluss soll kritisch hinterfragt werden, ob sich aus den Ergebnissen die vermeintlich große Bedeutung Tholucks für den deutschen Orientalismus ablesen lassen kann. Die Orientschriften von Tholuck, welche als Quellen dienen, sind dabei die „Blüthensammlung aus der morgenländischen Mystik: nebst einer Einleitung über Mystik überhaupt und Morgenländische insbesondere“ von 1825 und „Die speculative Trinitätslehre des späteren Orients“ von 1826.
Band 8
Tilman Hannemann (Hrsg): Studien zur Reformation in Bremen
Bremen 2016, xvii, 137 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00105487-18
Dieser Band vereinigt drei Texte zum bremischen Reformationsgeschehen, die einen Einblick in die Forschungstätigkeiten am Bremer Institut für Religionswissenschaft vermitteln. In allen drei Studien zeichnet sich ab, dass entlang der gemeinsamen Fragestellung nach Wandel vs. Kontinuität die Modi und Dimensionen der religiösen Verschiebungen im 16. Jahrhundert auf neue Weisen befragt werden. Dafür wird ein weites Quellenspektrum herangezogen – neben den klassischen Primärtexten sind auch visuelle und architektonische Zeugnisse in größerem Umfang berücksichtigt. Die Analysen tragen mit Methoden und Resultaten zu aktuellen Forschungszusammenhängen der Religionsästhetik und der Europäischen Religionsgeschichte bei.
Band 7
Gritt Klinkhammer und Eva Tolksdorf (Hrsg.): Somatisierung des Religiösen: Empirische Studien zum rezenten religiösen Heilungs- und Therapiemarkt
Bremen 2015, xii, 386 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00104231-10
Der vorliegende Sammelband bietet mit seiner Frage nach einer "Somatisierung des Religiösen" eine fokussierte Auswahl von insbesondere religionswissenschaftlichen sowie psychologischen, (medizin-)ethnologischen und soziologischen (qualitativ-)empirischen Studien zu rezenten Heilungs- und Therapieangeboten aus dem deutschen, niederländischen und US-amerikanischen Raum.
Vom 23. bis 25. Oktober 2013 fand in Hannover im Schloss Herrenhausen das von der Volkswagenstiftung geförderte Symposium "Somatisierung des Religiösen: Religionswissenschaftliche und -soziologische Perspektiven auf den rezenten religiösen Heilungs- und Therapiemarkt" statt, das den Ausgangspunkt für dieses Buchprojekt bildete. Hierbei wurden insbesondere 'westliche' Heilungsangebote aus dem charismatisch-evangelikalen, sufischen und esoterischen Spektrum vergleichend in den Blick genommen. Das Symposium hatte zum Ziel, das Embodiment-Paradigma aus religionswissenschaftlicher Perspektive methodologisch kritisch zu diskutieren und gegenwärtig laufende wie auch zukünftige empirische Forschungsprojekte anzuregen, die auf eine innovative Weise die Verwobenheit von Körperlichkeit und Religion in 'westlichen' religiösen Heilungs- und Therapiekontexten sowie Etablierungsbestrebungen in öffentlichen gesellschaftlichen (Gesundheits-)Bereichen thematisieren. Die gegenwärtige Koexistenz von religiösen und säkularen Diskursen ist hierbei als spezifische 'post-säkulare' Verwobenheit neu in den Blick zu nehmen. Dieser Band dokumentiert eine Auswahl der Vorträge, die zu ausführlichen Beiträgen erweitert wurden.
Band 6
Gritt Klinkhammer und Tabea Spieß(Hrsg.): Dialog als dritter Ort. Zehn Jahre Theologisches Forum Christentum Islam: eine Evaluation.
Bremen 2014, vi, 47 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00103998-15
Die vorliegende summative Evaluation basiert auf einer quantitativen und qualitativen Befragung der TeilnehmerInnen sowie der Steuerungsgruppe, teilnehmender Beobachtung einer Veranstaltung und der Sichtung weiteren, größten Teils auch öffentlich zugänglichen Materials des Theologischen Forum Christentum Islam an der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Eine solche Evaluation erscheint zunächst als sehr fokussierter Blick auf ein höchst spezifisches Dialogsetting, das zur Reflexion und potentiellen Weiterentwicklung genau dieses Settings dient. Es kann darüber hinaus aber auch als exemplarischer Fall zur allgemeinen Kriterienfindung für gelungene Dialogsettings dienen. Die Evaluationsergebnisse zum Teil auch in ihrer Differenz zu nachbarschaftlichen interreligiösen Dialoggruppen (Dialogos 2011) erscheinen uns zudem fruchtbar zur Reflexion der Arbeitsweise anderer interreligiöser Dialoggruppen wie zur Reflexion religiös pluraler gesellschaftlicher Konvivenz allgemein.
Band 5
Anke Drewitz (Hrsg.): Virtuelle Diskursgemeinschaften. Blogs und Foren als Orte religiöser Vergemeinschaftung junger deutschsprachiger Muslime
Bremen 2013, 111 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00103351-12
Religiöse Vergemeinschaftung findet seit jeher in unterschiedlichsten Formen statt. Gläubige versammeln sich regelmäßig in Moscheegemeinden und Kirchen, finden sich zeitweilig zu Bibelkreisen zusammen, entscheiden sich auf Dauer für das Leben in einem Kloster oder gehören für den begrenzten Zeitraum eines Kirchentages zu flüchtigen Eventgemeinschaften. Seit einigen Jahren ist auch das Internet zu einem Ort neuer Formen gemeinschaftlicher Religionsausübung geworden. Formate wie Blogs und Foren bieten die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, Glaubensinhalte zu verhandeln und auf dieser Basis Gemeinschaft zu erleben. Zentrales Charakteristikum solcher Virtuellen Diskursgemeinschaften ist die im virtuellen Raum stattfindende diskursive Aushandlung von Religion. Die Autorin der vorliegenden Untersuchung zeigt anhand der Analyse eines Blogs und eines Forums, die beide auf das Engagement junger deutschsprachiger Musliminnen und Muslime zurückgehen, wie sich mittels netzbasierter Kommunikation Rollenverteilung, soziale Normierung sowie Abgrenzungsprozesse vollziehen und somit religiöse Gemeinschaft entsteht.
Band 4
Marvin Döbler, Katharina Frank, Tilman Hannemann, Arendt Hindriksen, Tomoko, Ishikawa, Eva-Maria Kenngott, Gritt Klinkhammer, Jürgen Lott (Hrsg.): Religionspädagogik zwischen religionswissenschaftlichen Ansprüchen und pädagogischen Erwartungen
Bremen 2013, 172 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00103350-11
Dieser Band vereinigt Beiträge der Ringvorlesung "Religionswissenschaft & Religionspädagogik", die unter der Leitung von Arendt Hindriksen im Sommersemester 2011 an der Universität Bremen abgehalten wurde. Sie beleuchten das Verhältnis zwischen den beiden eng benachbarten Disziplinen aus fachhistorischer, empirischer und theoretischer Sicht. Die Schwerpunkte liegen auf Entwicklungen nichtkonfessioneller Konzepte der Religionspädagogik in den letzten 30 Jahren, Positionsbestimmungen des religionskundlich geprägten Unterrichts und der Rolle der Religionswissenschaft als Bezugswissenschaft. Behandelt werden u.a. der Biblische Geschichtsunterricht in Bremen, Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde in Brandenburg, Religion und Kultur im Kanton Zürich sowie Religionskulturerziehung in Japan.
Band 3
Gritt Klinkhammer und Heinrich de Wall (Hrsg.): Staatsvertrag mit Muslimen in Hamburg: Die rechts- und religionswissenschaftlichen Gutachten
Bremen 2012, 978-3-88722-737-1 , viii, 158 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00102852-13
In den letzten Jahren sind in verschiedenen Ländern der Bundesrepublik Deutschland Überlegungen zu gemeinsamen Verträgen zwischen Islamischen Religionsgemeinschaften und der jeweiligen Landesregierung angestellt worden. Die Freie und Hansestadt Hamburg hat sich als erstes Bundesland verbindlich zu einem Vertragsabschluss mit drei muslimischen Landesverbänden (DITIB, VIKZ, Schura) im August 2012 entschlossen. Die hier veröffentlichten Gutachten bilden neben den monatelangen Verhandlungen zwischen dem Hamburger Senat und den islamischen Landesverbänden eine der Grundlagen für die Entscheidung zu diesem Schritt. Hintergrund der Beauftragung dieser wissenschaftlichen Gutachten war die strittige Frage, ob bzw. inwieweit es sich bei den drei Hamburger Islamverbänden: DITIB, VIKZ und Schura um Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaften im Sinne des Grundgesetzes und nicht vielmehr um reine Interessensverbände handelt.
Band 2
Till Hagen Peters (Hrsg.): Islamismus bei Jugendlichen in empirischen Studien: Ein narratives Review.
Bremen 2012,978-3-88722-736-4 , iv, 112 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00102782-15
Der Begriff "Islamismus" verweist auf eines der schillerndsten und emotional aufgeladensten Themenfelder der letzten zehn bis fünfzehn Jahre. Derzeit ließe sich vermutlich kein zweites finden, dem ein ähnlich großes Interesse seitens der Medien, Politik und Wissenschaft gleichermaßen zukommt. So ist in Deutschland die Rede von „jungen Islamisten“ allgegenwärtig. Doch was genau verbirgt sich überhaupt hinter dem Begriff „Islamismus“ und sind die Hinweise auf "junge Islamisten" wissenschaftlich fundiert? Der Autor der vorliegenden Untersuchung widmet sich diesen Fragen aus religionswissenschaftlicher Perspektive. Er nimmt hierzu unterschiedliche Verwendungen des Begriffes „Islamismus“ in den Blick und analysiert empirische Studien, die sich mit Islamismus bei Jugendlichen in Deutschland beschäftigen.
Band 1
Gritt Klinkhammer, Hans-Ludwig Frese, Ayla Satilmis, Tina Seibert (Hrsg.): Interreligiöse und interkulturelle Dialoge mit MuslimInnen in Deutschland: Eine quantitative und qualitative Studie.
Bremen 2011, ISBN 978-3-88722-722-7 , xi, 404 Seiten.
Download -Version (pdf) via SUUB: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:gbv:46-00102006-15
Nach dem Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001, der vielfach als ein Angriff der ‚islamischen Welt‘ auf die ‚christlich-säkulare Zivilisation‘ gedeutet wurde, setzten viele zivilgesellschaftliche Kräfte zur innergesellschaftlichen Befriedung auf den Dialog zwischen ChristInnen und MuslimInnen. Interreligiöse Dialoginitiativen - bis dahin wenig beachtet und manches Mal als ‚gutmenschelndes‘ Nischenengagement belächelt - erhielten bald einen sicherheitspolitischen Stellenwert ersten Ranges.
Der vorliegende Band ist das Ergebnis einer mehrjährigen Forschungsarbeit zu interreligiösen und interkulturellen Dialogen zwischen ChristInnen und MuslimInnen, die in eigens für diesen Dialog gegründeten Initiativen - zum Teil unter Beteilgung von VertreterInnen auch anderer Religionsgemeinschaften und öffentlicher Stellen - stattgefunden haben.
Die Studie zeigt auf, wie die Dialoginitiativen arbeiten, mit welchen Hürden sie zu kämpfen haben und fragt, ob und unter welchen Umständen und mit welchen Mitteln die Initiativen ihre selbst gesteckten Ziele erfolgreich umsetzen. Die Untersuchung der Dialoginitiativen erfolgte sowohl unter integrationspolitischen und konfliktdynamisch-sozialpsychologischen wie unter religionswissenschaftlchen Hinsichten.